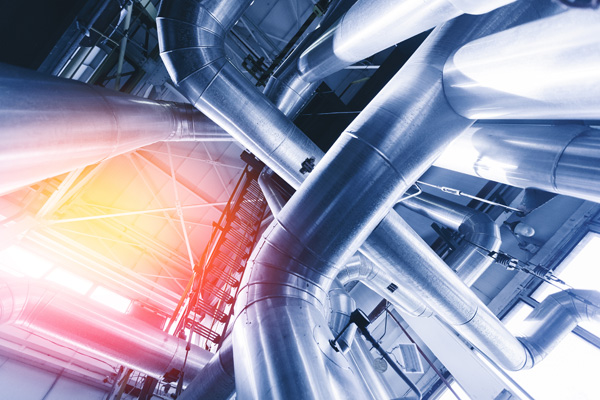
Smarte Materialien im Schatten des Smart Home
Intelligente Gebäudetechnik ist längst in vielen Bauprojekten angekommen – vom Lichtmanagement bis zur Heizungssteuerung per App. Doch während Smart-Home-Lösungen zunehmend zum Standard gehören, fristen smarte Materialien noch ein Nischendasein. Dabei besitzen sie großes Potenzial: Als adaptive Baustoffe reagieren sie auf Umwelteinflüsse und passen ihre Eigenschaften – etwa Temperatur, Lichtdurchlässigkeit oder Stabilität – dynamisch an. Eine aktuelle Studie der USP Marketing Consultancy unterstreicht jedoch: Das Wissen über diese Materialien ist in der Architekturbranche noch stark ausbaufähig.
Deutsche Planer mit überdurchschnittlichem Nachholbedarf
Für die Untersuchung wurden Ende Februar 2025 insgesamt 925 Architekturbüros in Europa befragt, darunter 125 in Deutschland. Das Ergebnis: Fast 44 Prozent der deutschen Befragten gaben an, smarte Materialien gar nicht zu kennen – deutlich mehr als in anderen europäischen Ländern. Viele Teilnehmende konnten auch auf Nachfrage keine klare Definition oder Anwendungsmöglichkeiten nennen. Zum Vergleich: In südeuropäischen Märkten wie Italien oder Spanien scheint das Thema bereits stärker präsent zu sein.
Smart-Home-Technik weit verbreitet – smarte Materialien kaum
Die Wissenslücke spiegelt sich auch in der tatsächlichen Projektpraxis wider. Während Smart-Home-Technologien inzwischen in etwa jedem dritten Projekt deutscher Architekturbüros eine Rolle spielen, liegt der Einsatz smarter Materialien bei gerade einmal zehn Prozent. Allerdings rechnen viele Planerinnen und Planer mit einer deutlich steigenden Bedeutung: Bis 2030 erwarten sie, dass smarte Materialien in etwa jedem zweiten Projekt zum Einsatz kommen könnten.
Hürden für die Marktdurchdringung: Wissen und Kosten
Als größte Herausforderungen für eine breitere Anwendung smarter Materialien sehen die Befragten zwei Punkte: Erstens fehlt es an Wissen über konkrete Einsatzmöglichkeiten und Vorteile. Zweitens gelten die Materialien nach wie vor als kostenintensiv. Diese Wahrnehmung hemmt die Offenheit vieler Projektverantwortlicher – selbst in Bereichen, in denen die Technologie klare Mehrwerte bietet, etwa in puncto Energieeffizienz oder Langlebigkeit.
Sensibilisierung und Aufklärung als Schlüssel zum Erfolg
Um die Marktakzeptanz zu erhöhen, empfehlen die Studienautoren gezielte Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen. Architektinnen und Architekten – insbesondere in leitender Funktion – müssten über die funktionalen und wirtschaftlichen Vorteile smarter Materialien informiert werden. Auch Hersteller und Verbände sind gefragt, mit Fallstudien und ROI-orientierten Argumenten für Transparenz zu sorgen.
Wohnungsbau als Innovationsmotor
Laut der Studie sehen viele Planerinnen und Planer im Wohnungsbau das größte Potenzial für den Einsatz smarter Materialien. Gleichzeitig wünschen sie sich klare Beispiele und Informationen zu Investitions- und Betriebskosten. Die Hoffnung: Wenn langfristige Einsparungen und Leistungsgewinne nachvollziehbar dargestellt werden, könnte das Thema in den nächsten Jahren deutlich an Relevanz gewinnen.





