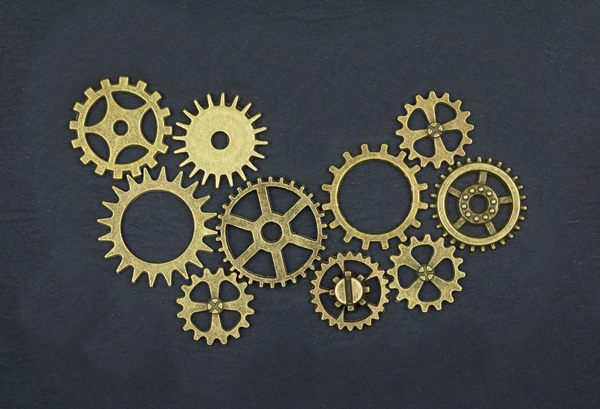
BFW-Konjunkturbericht Wohnen 2024/2025
Im Jahr 2024 ging die Zahl der genehmigten Wohnungen in Hessen spürbar zurück. Mit 13.772 Einheiten lag das Ergebnis um rund 27 Prozent unter dem Vorjahr. Gegenüber dem Höchststand im Jahr 2019 bedeutet dies einen Rückgang von über 54 Prozent. Besonders auffällig ist der Rückzug privater Haushalte aus dem Wohnungsbau, deren Genehmigungszahlen seit 2021 um 56 Prozent eingebrochen sind. Auch Anfang 2025 setzte sich der Abwärtstrend fort. Gleichzeitig nahm der Bauüberhang zu, was auf eine wachsende Lücke zwischen geplanter und umgesetzter Bautätigkeit hinweist.
Rückläufige Bautätigkeit auch in Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz wurden im Jahr 2024 insgesamt 10.951 Baugenehmigungen erteilt – ein Minus von über 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Während die Zahl der Neubaugenehmigungen um fast 19 Prozent sank, stieg die Zahl der Genehmigungen im Bestand leicht an. Der Anteil der Neubauten verringerte sich entsprechend. Seit dem konjunkturellen Wendepunkt im Jahr 2021 ist das Genehmigungsvolumen im Neubau in Rheinland-Pfalz um fast 49 Prozent geschrumpft. Auch der Bauüberhang reduzierte sich, was auf eine insgesamt sinkende Aktivität hinweist.
Private Investoren ziehen sich massiv zurück
Der Rückgang betrifft vor allem private Bauherren, die mit einem Anteil von 57 Prozent die Mehrheit der genehmigten Neubauten verantworten. Ihre Investitionen beliefen sich 2024 auf 1,9 Milliarden Euro, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu 2,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Seit 2021 ist die Anzahl ihrer Genehmigungen um 50 Prozent und das Investitionsvolumen um 43 Prozent gesunken. Die Entwicklung verdeutlicht eine spürbare Zurückhaltung dieser wichtigen Marktakteure.
Saarland mit besonders starkem Rückgang
Auch im Saarland verschlechterte sich die Lage. Die Zahl der Baugenehmigungen sank 2024 um rund 24 Prozent auf nur noch 1.142 Einheiten. Besonders betroffen war der Neubau mit einem Rückgang von nahezu 30 Prozent. Der Bauüberhang verringerte sich um über 22 Prozent. Private Bauherren spielten mit einem Anteil von 51 Prozent weiterhin eine zentrale Rolle, doch auch ihre Investitionen sanken massiv – um 37 Prozent bei der Anzahl der Genehmigungen und 31 Prozent beim Investitionsvolumen. Seit 2021 beträgt der Rückgang in dieser Gruppe sogar 65 Prozent bei den Genehmigungen und 59 Prozent bei den geplanten Ausgaben.
Politik muss schneller handeln – Wohnungsbau droht weiter zu schwächeln
Aus Sicht des BFW muss die neue Bundesregierung zügig Maßnahmen ergreifen, um den Wohnungsbau zu stabilisieren. Zwar seien im Koalitionsvertrag wichtige Ansätze wie die Reduzierung bürokratischer Hürden, die Einführung des Gebäudetyps E und die Förderung von Eigenkapitalbildung enthalten, doch fehlten konkrete Schritte zur Umsetzung. Wichtige Instrumente wie eine Senkung der Grunderwerbsteuer oder Lösungen für den Grundstücksmangel seien bislang unberücksichtigt geblieben.
Wohneigentum als Schlüssel zur sozialen Stabilität
Private Investitionen in Wohneigentum gelten als entscheidender Pfeiler für den Wohnungsbau. Ohne stärkere Anreize drohen nicht nur ein fortgesetzter Rückgang der Bautätigkeit, sondern auch zunehmender Druck auf die Mietmärkte. Der BFW betont, dass Wohneigentum ein wirksamer Schutz vor Altersarmut sei und verweist auf positive Beispiele aus anderen europäischen Ländern, wo die Eigentumsquote deutlich höher liegt.
Experten sehen keine kurzfristige Erholung
Professor Dr. Dieter Rebitzer, Mitverfasser des Berichts, erwartet auch für das Jahr 2025 keine Trendumkehr. Er rechnet bundesweit mit lediglich rund 200.000 neu genehmigten Wohnungen – weit entfernt vom politischen Ziel von jährlich 400.000 Einheiten. Gründe sieht er in gestiegenen Bauzinsen, anhaltend hohen Baukosten und der insgesamt schwachen gesamtwirtschaftlichen Lage. Ob und wann Reformen greifen, bleibt ungewiss.
Zusammenarbeit auf allen Ebenen erforderlich
Der Bericht unterstreicht die Notwendigkeit eines koordinierten Vorgehens von Bund, Ländern und Kommunen. Nur durch gemeinsame Anstrengungen könne der Wohnungsbau gestärkt, die Angebotslücke geschlossen und sozialen Spannungen entgegengewirkt werden.
Quelle: architekturblatt.de




