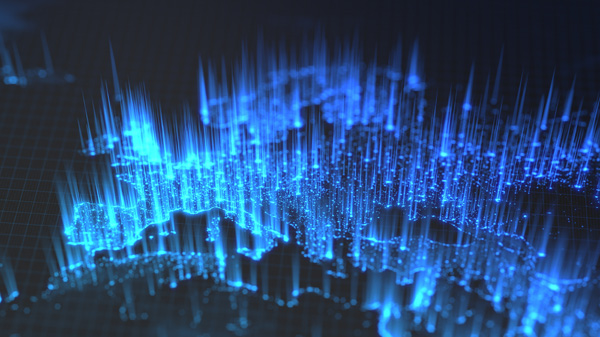
Neue Wohnwetterkarte zeigt Trendwende
Die Wohnwetterkarte 2025 dokumentiert eine klare Verschiebung der Nachfrage zurück in die Großstädte. Nach einer Phase starker Anspannung in ländlichen Räumen und Umlandgemeinden konzentriert sich der Druck wieder auf die Zentren, etwa in München, Berlin und Hamburg. Parallel dazu sinkt die Temperatur in vielen Umlandgemeinden leicht.
Besonders in den urbanen Räumen wirken mehrere Faktoren zusammen: Die Fertigstellungen neuer Wohnungen sind rückläufig, weil seit dem Zinsschock 2022 deutlich weniger Neubauprojekte gestartet wurden. 2024 sank die Zahl der Fertigstellungen auf 252.000 Einheiten. Die ausbleibende Eigentumsbildung verengt den Mietmarkt zusätzlich, da Haushalte länger in Mietwohnungen verweilen. Hinzu kommen höhere Tarifabschlüsse, die steigende Mieten tragbarer machen, sowie eine zunehmende Haushaltsverkleinerung und ein hoher Anteil von Zuwanderung.
Wohnungsbedarf auf Niveau von 2022
Die Methodik der Wohnwetterkarte ergibt einen jährlichen Bedarf von rund 440.000 Einheiten – und liegt damit wieder auf dem Niveau von 2022. Frühere Sondereffekte, etwa durch den Ukrainekrieg, fallen nicht mehr ins Gewicht. Neben Ersatz- und Zusatzbedarf wird auch Nachholbedarf berücksichtigt, allerdings graduell über mehrere Jahre verteilt. Entscheidend bleibt die räumliche Aussage: Die Metropolen stehen wieder im Zentrum der Anspannung, während kleinere Großstädte weiterhin ein wachsend warmes Wohnklima verzeichnen.
Ost-West-Unterschiede im ländlichen Raum
Erstmals zeigen sich gegenläufige Entwicklungen zwischen ländlichen Regionen in Ost- und Westdeutschland. Während im Westen ein insgesamt wärmeres Wohnklima zu beobachten ist, bleibt es in vielen ländlichen Gebieten des Ostens kühl. Dort wirkt die demografische Entwicklung besonders stark. Großstädte wie Leipzig, Dresden und Erfurt bilden jedoch Ausnahmen mit weiterhin hoher Nachfrage.
Konsequenzen für Praxis und Politik
Die Rückkehr der Nachfrage in die Großstädte bedeutet nicht das Ende der Relevanz des Umlands. Suburbane Standorte bleiben wichtige Ausweichräume, insbesondere für Mieterhaushalte, und können bei verbesserten Finanzierungsbedingungen auch wieder Impulse für die Eigentumsbildung liefern.
Für Kommunen und Projektentwickler ergibt sich die Aufgabe, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und Baukonzepte stärker auf lokale Nachfrageprofile auszurichten. Serielle Bauweisen, Nachverdichtung und Umnutzung gelten als Schlüssel, um das Angebot in angespannten Teilmärkten zu erweitern.




