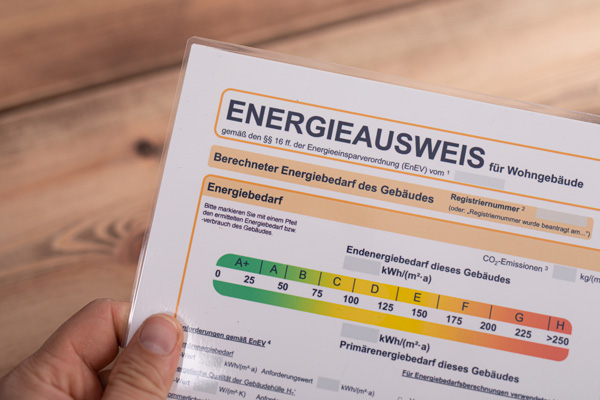
Serielle Sanierung auf dem Vormarsch
Die serielle Sanierung entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Bestandteil der energetischen Gebäudemodernisierung. Angetrieben durch den BEG-Bonus (Bundesförderung für effiziente Gebäude), hat sich der Anteil serieller Verfahren an den hocheffizienten Sanierungen in kurzer Zeit deutlich erhöht. Was einst als technologische Nische galt, wird inzwischen als industrielles Standardverfahren wahrgenommen. Digitale Planungsprozesse, modulare Bauweisen und staatliche Förderungen sorgen dabei für Effizienzgewinne, geringere Kosten und neue Geschäftsmöglichkeiten.
Wachsender Markt durch steigende Nachfrage
Seit Einführung des BEG-Bonus hat sich das Marktumfeld grundlegend verändert. Laut der Deutschen Energie-Agentur (dena) basiert mittlerweile fast jede vierte bewilligte Förderung für eine Sanierung zum Effizienzhaus 40 oder 55 auf seriellen Verfahren. Bauunternehmen und Handwerksbetriebe profitieren von neuen Geschäftsfeldern und besserer Planbarkeit. Christian Stolte, Bereichsleiter Klimaneutrale Gebäude bei der dena, bestätigt dass die steigende Nachfrage ist ein Innovationsmotor sei – immer mehr Unternehmen investieren in die Weiterentwicklung dieser Lösungen.
Skalierung ermöglicht wirtschaftliche Vorteile
Noch im Jahr 2022 ein Nischenthema, liegt der Marktanteil serieller Sanierung inzwischen bei rund 23 Prozent. Mit über 2.100 bewilligten Anträgen für etwa 11.600 Wohneinheiten gewinnen Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit an Bedeutung. Erste Praxisbeispiele belegen, dass seriell vorgefertigte Fassadenlösungen bis zu zehnmal schneller montiert werden können als klassische Systeme. Die steigende Zahl an Projekten verspricht Skaleneffekte, die zu sinkenden Kosten führen könnten.
Digitalisierung und Vorfertigung als Innovationstreiber
Auch jenseits des Geschosswohnungsbaus finden serielle Sanierungslösungen zunehmend Anwendung – etwa bei Ein- und Zweifamilienhäusern oder öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Kitas. Trotz fehlender Förderung in manchen Segmenten etabliert sich das Verfahren als dauerhaftes Sanierungsmodell. Die dena beziffert das bereits ausgelöste Bauvolumen auf rund zwei Milliarden Euro – mit weiterhin wachsender Tendenz.
Ein Milliardenmarkt mit langfristigem Potenzial
Das langfristige Marktpotenzial ist erheblich. Laut Schätzungen der dena könnten bis 2045 rund 500 Milliarden Euro in serielle Sanierung fließen. Besonders Gebäude aus den 1950er- bis 1970er-Jahren bieten enormes Nachholpotenzial. Die Möglichkeit, Sanierungskosten durch Energieeinsparungen zu refinanzieren, macht das Modell auch für Investoren und Wohnungsunternehmen zunehmend attraktiv.
Bayern und Nordrhein-Westfalen als Vorreiter
In der regionalen Betrachtung führen Bayern und Nordrhein-Westfalen das Feld an. Hier wurden bislang die meisten Wohneinheiten für serielle Sanierung genehmigt – unter anderem durch größere Pilotprojekte wie in Erlangen. Auch in weiteren Bundesländern wie Niedersachsen, Baden-Württemberg und Hessen nimmt das Interesse spürbar zu. Der sogenannte SerSan-Bonus wirkt damit weit über eine bloße Förderung hinaus: Er setzt starke wirtschaftliche Impulse und unterstützt die Bauwirtschaft auf ihrem Weg in eine klimaneutrale Zukunft.
Quelle: meistertipp.de




